Fremde | Heimat – Migrationsgeschichte über Objekte erleben
Von Kristin Schrimpf
2023 - 2025 Forschungsvolontärin im Siegerlandmuseum
»Ich hätte nicht erwartet, dass dieser Teppich mal in einem Museum hängt, neben, ich sag mal, „high art“: also Dingen, vor denen dann Leute stehen und sich eine halbe Stunde oder Stunde lang drüber austauschen.« - Marios Mouratidis, Leihgeber

1. Kurzinformationen zum Projekt
Das Forschungsprojekt mit dem Arbeitstitel „Fremde | Heimat – Migrationsgeschichte über Objekte erleben“ wurde im Zeitraum vom 01.01.2023 bis 31.12.2024 realisiert und hatte zur Zielsetzung, eine wichtige Lücke in der musealen Repräsentation im Siegerlandmuseum zu bearbeiten: die Lücke zum Thema Migration. Für die Projektrealisation konnte über eine Förderung durch das Programm „Forschungsvolontariat Kunstmuseen NRW“ eine Forschungsvolontariatsstelle am Siegerlandmuseum, befristet auf zwei Jahre, geschaffen werden, die mit Kristin Schrimpf besetzt wurde. Als großer Meilenstein innerhalb des Projekts hat am 03.05.2024 die Sonderausstellung „Siegen. Fremde? Heimat?“ eröffnet. Laufzeit der Ausstellung war bis zum 29.09.2024.

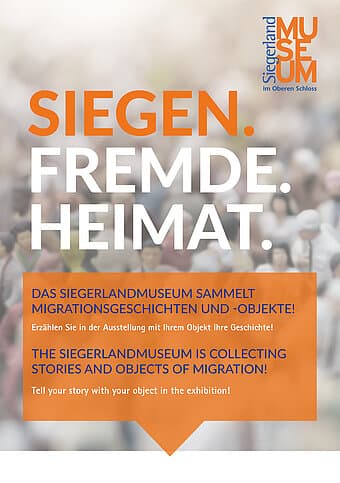




2. Theoretischer Rahmen
Migration wurde in diesem Projekt als räumliche und grenzüberschreitende Verlagerung des Lebensmittelpunktes (ins Siegerland ab 1945) verstanden, die Auswirkungen auf die Lebensverläufe der Menschen hatte/hat und sich auch auf die Lebensrealitäten und -erfahrungen der Nachkommen auswirkt. Das Thema Migration sollte damit nicht allein auf den Prozess des Ortswechselns bzw. das Leben in „Zwischenräumen“ reduziert werden und gleichzeitig verschiedenste Gründe für Migration einbeziehen – sei es zum Beispiel für die Arbeit, aus Liebe, Abenteuerlust oder infolge von Krieg und Verfolgung. Außerdem wurde Migration als zentrale Dimension globalisierter Gesellschaften und integrierter Teil davon gesehen.
Das Projekt sah vor, dass die Vermittlung der Migrationsthematik über Geschichten von Menschen mit Migrationserfahrungen in Kombination mit Objekten stattfinden soll. Im Bestand des Siegerlandmuseums befanden sich jedoch zu Projektbeginn wenig materielle Überlieferungen zu Migration – zumindest wenig als solche bekannte. Diese Ausgangslage machte es erforderlich, die Sammlungsbestände neu zu sichten und vor allem eine neue Sammlung zu dem Thema aufzubauen.
In Museumsdebatten rund um die Frage „Wer spricht?“ wird kritisch reflektiert, wessen Deutungen und Perspektiven Eingang in Ausstellungen finden. Ausgehend davon sollte die Sammlung zusammen mit Menschen mit persönlichen oder familiären Migrationserfahrungen aufgebaut werden und aus persönlichen Objekten bestehen, die mit persönlichen Erinnerungen, Erfahrungen und Geschichten verbunden sind und zugleich in bestimmte historische, politische und gesellschaftliche Kontexte eingebettet sind. Grundlage dafür ist die Annahme, dass Objekte im Zuge von persönlichen oder familiären Migrationserfahrungen bestimmte Deutungen erfahren. Objekte rücken also mitsamt ihrer unmittelbaren Verbindung mit konkreten Erzählungen in den Mittelpunkt oder, andersherum betrachtet, individuelle Erinnerungen und Erfahrungen mitsamt den Objekten, die darin vorkommen. Menschen mit Migrationserfahrungen sollen damit über ihre Objekte zu Wort kommen und zum Subjekt der Erzählungen werden. Nicht der Standpunkt des Siegerlandes als Ankunftsregion ist der Ausgangspunkt, sondern der Standpunkt der Menschen mit Migrationserfahrungen.
3. Beteiligungsformate
Im Projektzeitraum wurden drei beteiligungsorientierte Formate entwickelt und durchgeführt:

Die sogenannten Frage-Antwort-Stühle waren das erste Format innerhalb des Projekts und konzipiert als ein erstes Herantasten daran, was in der Stadtgesellschaft für Erfahrungen mit Migration vorhanden sind. Außerdem war dieses Format der Beitrag des Siegerlandmuseums zum Freundschaftsfest 2023. Das Freundschaftsfest ist ein Fest in Siegen, das einmal im Jahr vom Integrationsbeauftragten der Stadt organisiert wird. Auf dem Fest können sich migrantische Selbstorganisationen und Vereine vorstellen und Dinge anbieten. Auch andere im Bereich Migration aktive Akteure und Akteurinnen wie die Integrationsagenturen der Wohlfahrtsverbände sind vertreten. Im Jahr 2023 hat das Fest im Schlosspark um das Museum herum stattgefunden. Das Format der Frage-Antwort-Stühle hatte also eine doppelte Funktion: einerseits erste Daten für das Projekt sammeln und andererseits Präsenz zeigen, sichtbar machen, dass das Siegerlandmuseum sich mit dem Thema Migration beschäftigt, und das Museum im Umfeld der Vereine, Organisationen und ihren Mitgliedern verankern. Außerdem war das Fest eine gute Chance, um erste persönliche Kontakte herzustellen.
Das Prinzip der Stühle bestand darin, dass an den Rückenlehnen der Stühle Fragen rund um das Thema Migration ins Siegerland angebracht wurden, die sich per QR-Code-Scan mit dem Smartphone beantworten ließen. Die Stühle wurden an verschiedenen Stellen auf dem Gelände des Freundschaftsfests, am Wegesrand oder auf der Schlosswiese, aufgestellt. Ein Teil der Fragen richtete sich explizit an Menschen mit persönlichen oder familiären Migrationserfahrungen, ein anderer Teil wiederum war sehr offen gestellt und konnte sowohl Menschen mit als auch ohne Einwanderungsgeschichte ansprechen. Zum Beispiel wurde die Frage gestellt, an welchen Orten und in welchen Situationen Migration das Leben der Befragten berührt (auf Deutsch und Englisch).
Was die Zielsetzung der Datensammlung betrifft, ist das Format nicht aufgegangen, weil Freundschaftsfestbesuchende die Stühle für Picknicks umfunktioniert haben und sich dauerhaft darauf zusammengesetzt haben. Die Stühle waren dann nicht mehr als Angebot bzw. Aktion erkenntlich. Im Hinblick auf die zweite Funktion des Formats hat es sich aber dennoch gelohnt, weil erste persönliche Kontakte zu migrantischen Selbstorganisationen, Vereinen sowie Privatpersonen entstanden sind, aus denen auch eine Leihgabe für die Sonderausstellung hervorgegangen ist.

Bei „Mind the gap“ handelte es sich um ein interaktives und dialogisches Führungsangebot durch die derzeitige Dauerausstellung zur Stadtgeschichte im Siegerlandmuseum, die, angelehnt an die Methode „revisiting collections“ , vor allem der Neusichtung und Reflexion der ausgestellten Sammlungsbestände diente. Kerngedanke der Methode ist, dass Objekte mehr Bedeutungsschichten haben können, als den Sammlungsverantwortlichen im Museum bekannt ist. Sprich, dass mehrere Perspektiven auf ein und dasselbe Objekt existieren und dass man solche Perspektiven und Bedeutungsschichten darüber finden kann, dass man zusammen mit anderen Menschen mit anderem Erfahrungswissen auf die Objekte blickt. Übertragen auf „Fremde | Heimat – Migrationsgeschichte über Objekte erleben“ hieß das, dass Objekte aus den Sammlungsbeständen des Siegerlandmuseums womöglich Geschichten über Migration erzählen können, diese aber erst gemeinsam mit Externen entdeckt werden müssen. Dementsprechend war es in dem Führungsangebot aktiv eingeplant, dass sich die Teilnehmenden dazwischenschalten und intervenieren, wenn ihnen in der Präsentation zur Stadtgeschichte Lücken mit Blick auf das Thema Migration auffallen oder wenn sie Objekte finden, die etwas über Migration erzählen könnten, auch wenn sie es in der aktuellen Präsentation nicht tun.
Für das Angebot wurden Verkehrshütchen angeschafft, die die Besuchenden in die Hand bekommen haben und an den Stellen im Museum platzieren konnten, wo ihrer Meinung nach etwas fehlte oder ergänzt werden konnte – als Zeichen, dass dort in diesem Sinne eine „Baustelle“ vorlag. Durchgeführt wurde das Format zweimal im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Interkulturelle Tage“ in Siegen (am 24.09.2023 um 14:30 Uhr und am 27.09.2023 um 17:00 Uhr). Am ersten Termin haben 12 Leute teilgenommen, am zweiten drei. Bei beiden Terminen sind mehrere Ideen geteilt und Hütchen platziert worden, zum Beispiel an der Vitrine, in der zwei kleine Replikationen der Bronzefiguren „Henner“ und „Frieder“ präsentiert sind, stellvertretend für die sogenannten „Gastarbeiter“ und „Gastarbeiterinnen“, die insbesondere im Montanbereich angeworben worden sind.
Zum Zeitpunkt der Format-Durchführung war es angedacht, die gesammelten Ideen als Inhalte in die Sonderausstellung “Siegen. Fremde? Heimat?” einzubauen. Durch Weiterentwicklungen des Ausstellungskonzepts und die Fokussierung auf einzelne, persönliche Objektleihgaben ist das jedoch in den Hintergrund gerückt. Stattdessen ist der Einbezug der gesammelten Inhalte nun für die geplante Neukonzeption der stadtgeschichtlichen Abteilung vorgesehen.
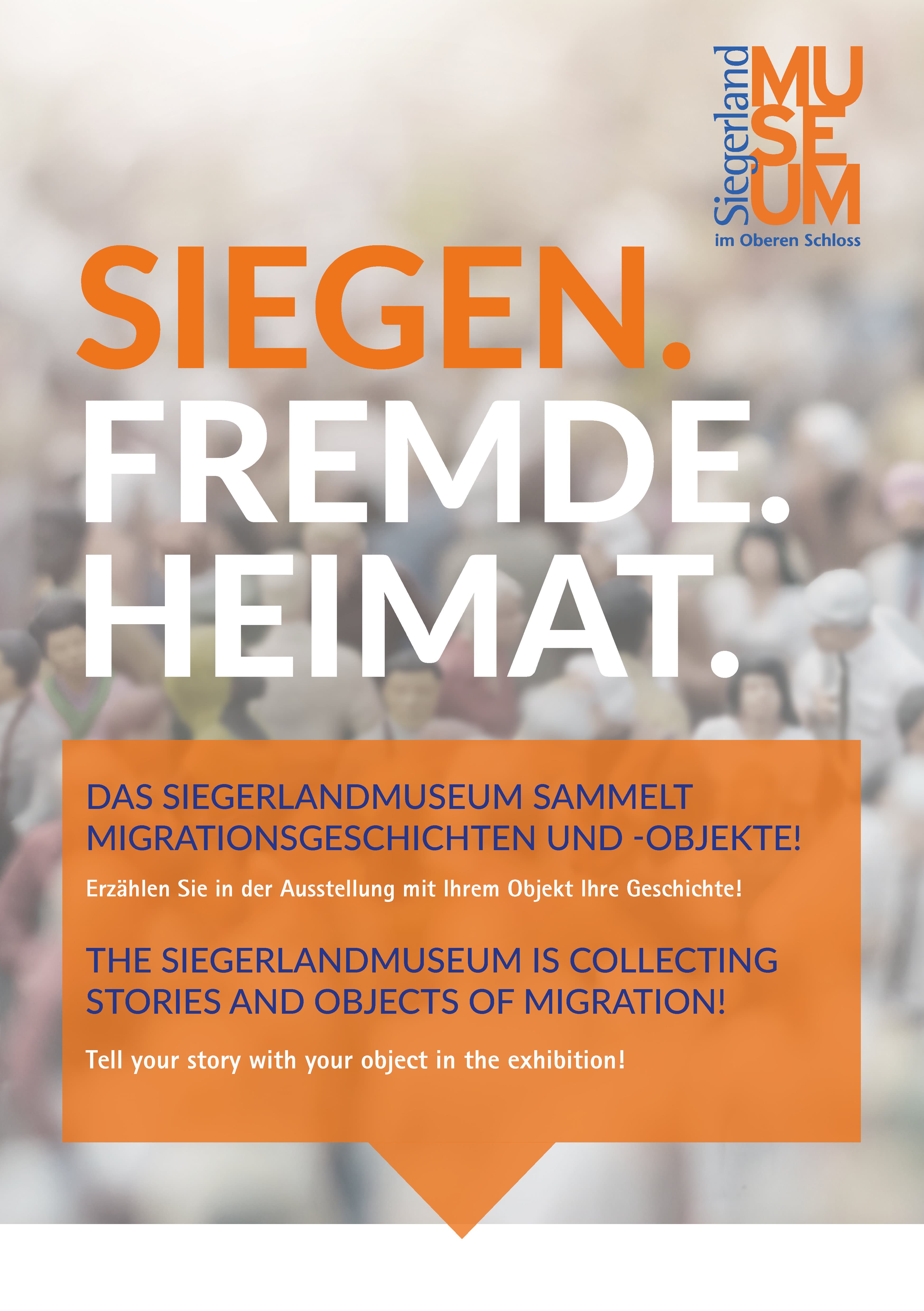
Das umfangreichste Format, das auch am stärksten in die Ausstellung „Siegen. Fremde? Heimat?“ eingeflossen ist, ist der öffentliche Sammelaufruf, in dem es hieß, dass wir als Museum Geschichten und Objekte sammeln, die etwas über persönliche oder familiäre Erfahrungen mit Migration ins Siegerland erzählen können. Dieses Format könnte man unter das Schlagwort „partizipatives Sammeln“ fassen, denn über die Teilnahme am Sammelaufruf konnten die Teilnehmenden aktiv Einfluss darauf nehmen, was in der Ausstellung gezeigt, thematisiert und damit sichtbar gemacht wurde.
Der Startschuss wurde auf dem Freundschaftsfest 2023 gegeben, auf dem Kristin Schrimpf das persönliche Gespräch mit den anwesenden migrantischen Vereinen und Organisationen gesucht und Flyer zum Sammelaufruf verteilt hat. Flyer wurden außerdem an möglichst vielen verschiedenen Orten der Stadt ausgelegt, zum Beispiel in der Stadtbibliothek, in der Uni Mensa am Unteren Schloss, im FabLab, in Cafés, im Stadtteilbüro Fritz-Erler-Siedlung, im Freibad Geisweid und bei der Judo Vereinigung Siegerland. Darüber hinaus wurden für die Bekanntmachung verschiedene digitale Kanäle benutzt – sowohl die des Siegerlandmuseums und der Stadt Siegen als auch externe wie zum Beispiel vom International Office der Universität Siegen. Über den E-Mail-Verteiler vom Integrationsbeauftragten der Stadt Siegen wurde der Aufruf an sein Netzwerk migrantischer Akteure und Akteurinnen versandt. Außerdem wurde der Aufruf in der Siegener Zeitung sowie in den zwei Zeitschriften „Migazette“ und „durchblick“ veröffentlicht. Auch über persönliche Kontakte von Kollegen und Kolleginnen ist der Sammelaufruf weitergetragen worden. Teils ist Kristin Schrimpf auch selbst aktiv auf Menschen zugegangen, die mit ihren Geschichten schon mal an die Öffentlichkeit gegangen waren. Außerdem hat sie den Sammelaufruf persönlich in einem sogenannten MiA-Kurs vom Internationalen Bund vorgestellt (Abkürzung steht für: Migrantinnen einfach stark im Alltag).
Am Anfang war die Resonanz auf den Sammelaufruf erstmal gering. Außerdem hat die Erfahrung aus ersten Kontaktaufnahmen gezeigt, dass viele Menschen intuitiv zunächst gedacht haben, dass sie sowieso nichts Museumswürdiges beizusteuern hätten. Dem wurde damit begegnet, dass mithilfe von Beispielen aus anderen verwandten Museumsprojekten gezeigt worden ist, dass eben auch ganz alltägliche Objekte wie zum Beispiel eine Packung Kartoffelmehl für Klöße spannend sein und Geschichten erzählen können. Mit der Zeit, als die Ansprache immer breiter aufgestellt wurde, ist der Sammelaufruf dann doch ins Rollen gekommen. Insgesamt haben sich 21 Personen gemeldet, von denen 14 Personen mit insgesamt 16 Objekten und Geschichten in die Ausstellung eingegangen sind.
Nach der ersten Kontaktaufnahme und dem ersten Austausch per Telefon, E-Mail oder persönlich hat Kristin Schrimpf mit 16 Personen einen Termin für ein persönliches Treffen ausgemacht. Bei den anderen fünf Personen ist es bei einem telefonischen Austausch oder per Mail geblieben. Je nachdem, wie es den Leihgebenden am besten gepasst hat, haben die Treffen bei ihnen zu Hause, im Siegerlandmuseum oder in externen Räumen stattgefunden. Jedes Treffen ist individuell verlaufen. In manchen Fällen hatten Leihgebende schon von Anfang an Ideen für konkrete Leihobjekte, in anderen Fällen haben sich erst in den Gesprächen Ideen für konkrete Leihobjekte ergeben. Teils wurde der Sammelaufruf dabei zunächst so aufgefasst, dass Objekte gesucht werden, die für die eigene Herkunftsregion „typisch“ oder repräsentativ sind. Dem wurde begegnet, indem das Gespräch dahin geleitet wurde, dass es um die persönliche Dimension von Migration geht – persönliche Objekte, die etwas über den eigenen, individuellen Prozess der Migration oder Lebensalltag erzählen.
Die Gespräche wurden über Gedächtnisprotokolle dokumentiert, die direkt im Anschluss an die Gespräche verfasst wurden. Die Protokolle wurden nach Methoden der qualitativen Forschung ausgewertet und in komprimierte Fließtexte zu einzelnen Objekten gegossen. Teils mussten diese Texte, bedingt durch den Cyber-Angriff auf die SIT im Herbst 2023, übergangsweise aus dem Gedächtnis verfasst werden. Sie konnten jedoch, nachdem der Zugriff auf die Daten im Frühjahr 2024 wiederhergestellt wurde, mit den Protokollen und Notizen abgeglichen werden und wurden den Leihgebenden zur Korrektur vorgelegt.
Da es Ziel des Sammelaufrufs war, die Stadtgesellschaft Einfluss darauf nehmen zu lassen, was in der Ausstellung gezeigt, thematisiert und sichtbar gemacht wird, wurde angestrebt, möglichst wenig als Institution zu selektieren. Mit wenigen Ausnahmen wurde erst einmal alles gesammelt, was dem Museum aktiv angeboten wurde. Insgesamt sind 33 Einzelobjekte in die temporäre Sammlung eingegangen. Von diesen 33 Objekten sind wiederum 16 in die Ausstellung eingegangen. Teils war es so, dass ein und dieselbe Person mehrere Objekte abgegeben hat. In diesen Fällen wurden bis zu zwei Objekte je Leihgeber/in ausgesucht, damit keine Person mit ihrer Biografie und ihren Geschichten in der Ausstellung stärker vertreten war als andere. Außerdem wurde geschaut, zu welchen Objekten die meisten Informationen vorlagen und wo sich, entsprechend dem Ausstellungskonzept (siehe 4. Konzept der Ausstellung), die tiefsten Verbindungslinien zu Objekten aus unserer Dauerausstellung aufgetan haben. Da die finale Autorität über die Auswahl und Darstellung der Objekte und Geschichten dem Museum oblag, folgte das Format des Sammelaufrufs als Ganzes eher einem partizipativ-kooperativen Ansatz.
4. Konzept der Ausstellung
Das Ausstellungskonzept stellte Migration als selbstverständlichen und integrierten Teil der Stadtgeschichte und der Stadtgesellschaft in den Vordergrund. Um dies sichtbar zu machen, wurden die Leihobjekte, die über den Sammelaufruf ins Siegerlandmuseum gekommen waren, für den Zeitraum der Sonderausstellung in die Dauerausstellung des Siegerlandmuseums integriert. Jedes Leihobjekt wurde dabei mit einem Objekt (manchmal auch einer Gruppe von Objekten) aus der Dauerausstellung in einen Dialog gebracht und zusammen bildeten sie eine Station der Ausstellung. Diese „Objektverpartnerungen“ beruhten auf einem gemeinsamen Thema, das beide Objekte – Leihobjekt und Dauerausstellungsobjekt – miteinander verband. Das musste kein Thema sein, das bei der aktuellen Präsentation des Dauerausstellungsobjekts thematisiert wurde, sondern konnte auch ein Thema sein, dass bei der Objektrecherche in den Objektakten und Katalogen oder bei Gesprächen über die Objekte mit Kollegen und Kolleginnen aufgespürt wurde. Es ging sprich nicht darum, die Leihobjekte in aktuelle Erzählungen im Ausstellungsbereich passend unterzuheben, sondern darum, Beziehungen zwischen einzelnen Objekten erkundbar zu machen. Damit wurde abgefedert, was im Sammlungsaufruf potenziell angelegt war: Dass Objekte gesammelt wurden, die im Migrationsprozess bestimmte Bedeutungen erfahren haben und als solche präsentiert werden, birgt die Gefahr, dass diese Objekte in der Ausstellung als different wahrgenommen werden. Durch das Prinzip der Beziehung, auf dem die Ausstellung beruht, wurde das Augenmerkt hingegen auf Gemeinsamkeiten gelegt, ohne konkrete Lebensrealitäten von Menschen mit persönlichen oder familiären Migrationserfahrungen auf der Strecke zu lassen.
In der Ausstellung wurden die Objekte wortwörtlich in einen Dialog gebracht, denn die Vermittlung in der Ausstellung funktionierte über die Audioebene und in den Audiospuren sprachen die Objekte selbst und zueinander. In diesen Dialogen wurde der Beziehungszusammenhang zwischen den Objekten erkundbar. Die Dialoge endeten immer auf Fragen, die an die Besuchenden gerichtet waren und sie dazu motivieren sollten, ihren eigenen Bezug zur Ausstellung zu erkunden. Technisch funktionierte die Vermittlung über Audio per QR-Code Scan mit dem eigenen Smartphone. Als Alternative wurden Spiralbücher mit den ausgedruckten Transkripten bereitgestellt. Die Hörtexte konnten auf Deutsch und Englisch abgerufen und darüber hinaus in fünf weiteren Sprachen – die Sprachen, die die Leihgebenden oder ihre Familien als Muttersprache sprechen – nachgelesen werden.
Die Sonderausstellungsfläche des Siegerlandmuseums wurde als sogenanntes Forum zur Ausstellung genutzt. Das Forum ergänzte die Sonderausstellung nicht um weitere Exponate, sondern um einen Platz zum Austauschen und Hinter-die-Kulissen-Blicken. Jeder Raum beziehungsweise Bereich hatte seine eigene Funktion. Der vorderste war als eine Art „Making of“ der Genese der Ausstellung gewidmet. Hier wurde ein digitaler „Avatar“ der Kuratorin an die Wand projiziert, dem interaktiv Fragen zur Ausstellungsentstehung gestellt werden konnten. Ein weiterer Bereich enthielt zwei partizipative Stationen und gab den Besuchenden die Möglichkeit, sich zu in der Ausstellung aufgeworfenen Fragestellungen und Themen zu äußern. Eine der Stationen nahm auf den Ausstellungstitel Bezug und fragte danach, was die Begriffe „Fremde“ und „Heimat“ für die Besuchenden bedeuten. Die zweite Station nahm Bezug auf die Stationen in der Dauerausstellung und bot die Möglichkeit, diese mit eigenen Gedanken und Assoziationen zu kommentieren. Ein weiterer Bereich war mit Sitzwürfeln, einem Kaffeeautomaten und einem Whiteboard ausgestattet und diente als Workshop- und Aufenthaltsraum für Besuchende und externe Gruppen. Ein weiterer Raum war für Inhalte reserviert, die während der Laufzeit der Ausstellung entstanden sind (Ergebnisse aus dem Workshop „Sounds of Siegen“ für Kinder und Jugendliche sowie aus der Kooperation mit dem medienwissenschaftlichen Seminar „Migrationsgeschichte(n) des Siegerlandes“ der Universität Siegen).
Hinter den Begriffen „Fremde“ und „Heimat“ im Projekt- sowie im späteren Ausstellungstitel wurden im Laufe der Projektlaufzeit Fragezeichen ergänzt. Das liegt darin begründet, dass „Fremde“ und „Heimat“ große Begriffe sind, die alle Menschen mit eigenen Inhalten füllen und mit sehr individuellen Gefühlen verbinden. Oft werden die Begriffe jedoch als Gegensätze gehandelt und für Zwecke der Ausgrenzung instrumentalisiert. Die Fragezeichen sollen darauf verweisen, dass in der Ausstellung diese gegenüberstellende, hierarchisierende Sicht auf Heimat hinterfragt wurde, indem Objekte in einen Dialog gebracht und Beziehungen erkundbar gemacht wurden: Wo hört das vermeintlich „Eigene“ auf und wo fängt das vermeintlich „Fremde“ an? Außerdem geben die Fragezeichen Hinweise darauf, dass die Besuchenden in der Ausstellung aktiv in das Erkunden der Begriffe einbezogen wurden.

»Ich war schon tausendmal in diesem Museum und dann dachte ich mir irgendwie so, jetzt habe ich irgendetwas von meiner Heimat, oder irgendetwas von mir da drin, ja.« - anonyme Leihgeberin
